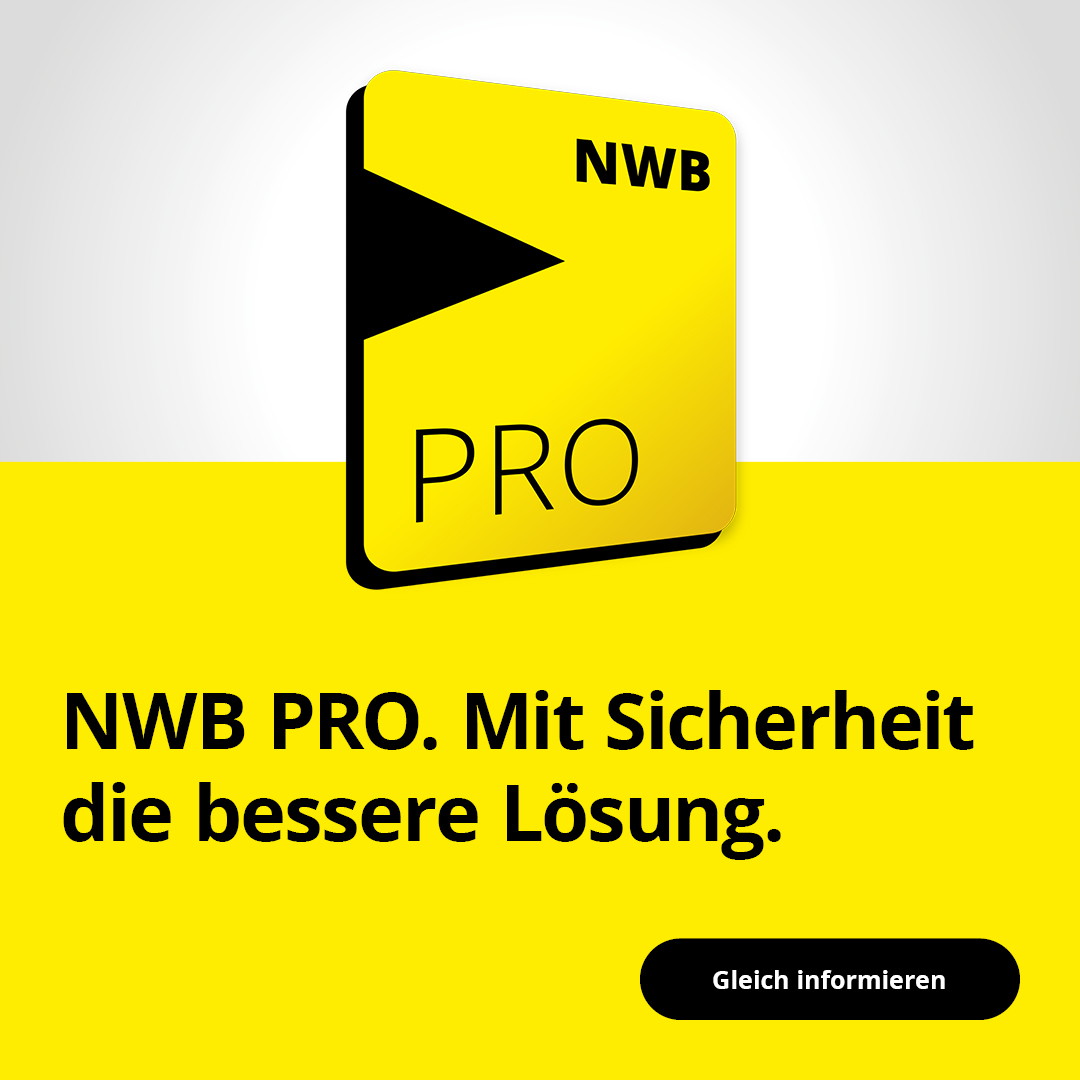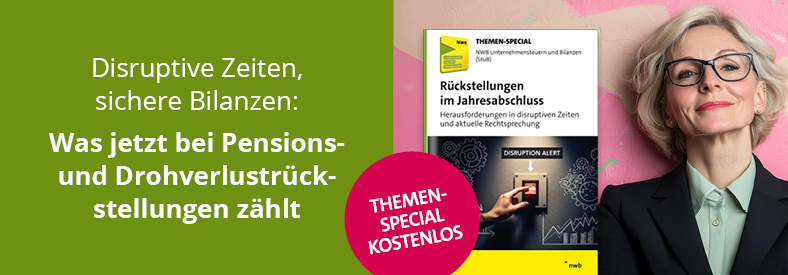Rückstellungen im Jahresabschluss
Rückstellungen sind in Theorie sowie Praxis unverändert einer der Bilanzposten mit dem höchsten Grad an Komplexität. Das Spektrum reicht von Fragen zum Ansatz über die Bewertung bis hin zu bilanzpolitischen Fragestellungen, die nicht selten Gegenstand finanzgerichtlicher Verfahren und höchstrichterlicher Rechtsprechung sind.
Die unverändert von verschiedenen Krisen geprägte gesamtwirtschaftliche Lage führt für aktuelle Jahresabschlüsse zu verschiedenen Herausforderungen im Bereich der Rückstellungen in Handels- als auch Steuerrecht.
In der Praxis bestehen insbesondere für Pensionsrückstellungen und Drohverlustrückstellungen durch Themen wie Inflation, das gestiegene Zinsniveau, die Folgen des Klimawandels und die Folgen geopolitischer Spannungen zahlreiche Aspekte, die es beim Ansatz und der Bewertung von Rückstellungen zu berücksichtigen gilt. Hinzu kommt die zunehmende Diskrepanz zwischen Handels- und Steuerbilanz, die sich auch im Bereich der Rückstellungen niederschlagen kann und damit letztendlich die Bedeutung von latenten Steuern steigen lässt.
Die Bilanzierung und Bewertung von Rückstellungen erfahren zudem durch die laufende Rechtsprechung kontinuierlich neue Erkenntnisse, welche es für die Unternehmenspraxis zu beachten gilt.
I. Einordnung
Die vergangenen Jahre waren geprägt von großen Herausforderungen für die Unternehmen und die Wirtschaft verschiedenster Art. Zu Jahresbeginn 2020 breitete sich das Corona-Virus weltweit aus, wodurch Lieferketten gestört, Werke geschlossen und Zahlungen verzögert wurden. Russland begann im Februar 2022 einen Angriffskrieg auf die Ukraine, was zu einer europäischen Energiekrise und einer deutlichen Inflation führte. Daraufhin stieg das Zinsniveau nach einer langjährigen Nullzinsphase wieder an. Im April 2025 wurde die neue US-Zollpolitik verkündet, die von einer hohen Dynamik geprägt ist und damit weltweit für Verunsicherung in der Wirtschaft sorgt. Zudem prägen auch Demographie- und Klimawandel zunehmend das wirtschaftliche Umfeld.
Bilanzierende haben sich auf diese Veränderungen einzustellen, die Folgen zu analysieren und die Auswirkungen auf die Erstellung von Jahresabschlüssen zu übertragen. Rückstellungen gehören zu den komplexesten Bilanzposten, weshalb sich durch die vorstehenden Ereignisse zahlreiche Fragestellungen zur bilanziellen Berücksichtigung ergeben. Insbesondere die Pensionsrückstellungen und die Drohverlustrückstellung sind durch die vorstehenden Ereignisse in den Fokus gerückt.
Gerade das steigende Zinsniveau hat weitreichende Folgen auf langfristige Rückstellungen, da diese über ihre Restlaufzeit abzuzinsen sind. Gleichzeitig sind auch inflationsbedingte Lohn- und Rentensteigerungen zu berücksichtigen.
Wenn und soweit Unternehmen aus heutiger Sicht Verträge abgeschlossen haben, die zu einem künftigen Nachteil für die Unternehmen führen, sind dabei der Ansatz und die Bewertung von Drohverlustrückstellungen zu beachten.
Ansatz, Bewertung und bilanzpolitische Gestaltung sind auch regelmäßig Gegenstand gerichtlicher Auseinandersetzungen. Die Rechtsprechung liefert fortlaufend neue Erkenntnisse, die in der Praxis zu berücksichtigen sind.
II. Fazit
Die disruptiven Ereignisse der jüngeren Vergangenheit haben weitreichende Folgen auf die Bilanzierung im Allgemeinen und auf das Institut der Rückstellungen im Besonderen gehabt. Die in den letzten Jahren hohe Inflation und die daraus folgende Abkehr von der Nullzinspolitik der EZB haben weitreichende Auswirkungen auf die Bewertung von Pensionsrückstellungen mit sich gebracht.
Bilanzierende müssen für solche Entwicklungen und deren bilanzielle Folgewirkungen sensibilisiert sein. Pensionsrückstellungen sind nicht selten Bilanzpositionen von enormem Umfang, sodass Änderungen der Bewertungsparameter weitreichende Folgen nach sich ziehen können. Dadurch kann es zu massiven negativen Ergebniseffekten in der Handelsbilanz kommen. Zwangsläufig treten solche ergebnismindernden Effekte durch die Umkehr des Verhältnisses des Sieben-Jahres-Durchschnittssatz zum Zehn-Jahres-Durchschnittssatz ein. Aus diesem Grund sollte der Gesetzgeber auch die Vorschrift zum Zehn-Jahres-Durchschnittssatz anpassen, da sich seine damalige Intention zur Entlastung der Unternehmen durch das derzeitige Zinsniveau umgekehrt hat und Unternehmen nunmehr belastet werden.
Die Thematik der Drohverlustrückstellungen wird wohl zukünftig immer mehr an Bedeutung gewinnen, da der zunehmende Protektionismus, die derzeit wachsenden geopolitischen Spannungen, Extremwetterereignisse durch den Klimawandel und die der Zukunft inhärente Unsicherheit steigen und Unternehmensplanungen zumindest auf absehbare Zeit schwieriger werden lassen.
Damit steigt die Wahrscheinlichkeit u. a. für Fehlkalkulationen oder unerwartete, nachträgliche und nicht weiterbelastbare Preissteigerungen, die die Bildung einer Drohverlustrückstellung erfordern. Damit steigt auch u. E. das Unverständnis für das steuerliche Ansatzverbot von Drohverlustrückstellungen, das rein fiskalpolitisch motiviert ist.
Die derzeit wohl noch verfassungsrechtlich konforme Grundlage für das Ansatzverbot könnte mit der zunehmenden Bedeutung des Instituts der Drohverlustrückstellung möglicherweise ins Wanken geraten. Aus Sicht der Steuerpflichtigen wäre es jedenfalls zu begrüßen, nicht zuletzt, dass dadurch die schwierige Frage der Abgrenzung zwischen zulässiger Verbindlichkeitsrückstellung und nicht zulässiger Drohverlustrückstellung entfallen würde.
Unter Umständen könnte sich dadurch auch die Rechtsprechung mit dem steuerlichen Ansatzverbot von Drohverlustrückstellungen befassen und sich zu dessen Verfassungsmäßigkeit äußern. Die Thematik der Rückstellungen ist allgemein geprägt durch die Erkenntnisse aus der Rechtsprechung. Diese führt zu kontinuierlich neuen Erkenntnissen, die für die Unternehmenspraxis von großer Bedeutung sind. Dabei reicht die Rechtsprechung oftmals über den Gegenstand des jeweiligen Verfahrens hinaus. Die Bilanzierenden können die Erkenntnisse als Hilfestellung nutzen und auf eigene Problemstellungen übertragen. Damit erhalten sie einen Leitfaden für den Ansatz und die Bewertung von Rückstellungen.
Unverändert kommt dem Bereich der Rückstellungen nicht nur in der Praxis eine hohe Bedeutung zu. Regelmäßig sind Rückstellungen auch Gegenstand der (höchstrichterlichen) Rechtsprechung. Hierbei kommt auch dem BFH eine wichtige Bedeutung bei der Auslegung von handelsrechtlichen Grundsätzen zu. Darüber hinaus konkretisieren Verlautbarungen des IDW eine Vielzahl von Zweifelsfragen, so bspw. IDW RS HFA 4 (Drohverlustrückstellungen), IDW RS HFA 30 zur Bilanzierung von Altersversorgungsverpflichtungen oder IDW RS HFA 34 zu Einzelfragen im Kontext von Verbindlichkeitsrückstellungen.
Die unverändert von verschiedenen Krisen geprägte gesamtwirtschaftliche Lage führt für aktuelle Jahresabschlüsse zu verschiedenen Herausforderungen im Bereich der Rückstellungen. Bei der Bilanzierung von Rückstellungen ist die Handelsbilanz zwar grundsätzlich maßgebend. Allerdings sind in der Steuerbilanz zahlreiche steuerrechtliche Vorbehalte zu beachten. In der Praxis bestehen insbesondere für Pensionsrückstellungen und Drohverlustrückstellungen durch Themen wie Inflation, das gestiegene Zinsniveau, die Folgen des Klimawandels und die Folgen geopolitischer Spannungen zahlreiche Aspekte, die es beim Ansatz und der Bewertung von Rückstellungen zu berücksichtigen gilt.
Das Themen-Special aus dem Paket NWB Unternehmensteuern und Bilanzen – StuB leistet Hilfestellung bei der Bilanzierung und Bewertung von Rückstellungen und legt den Fokus auf aktuelle Entwicklungen.
Das vollständige Themen-Special finden Sie als Abonnent in der NWB Datenbank unter NWB JAAAK-03830.
Das könnte Sie auch interessieren: