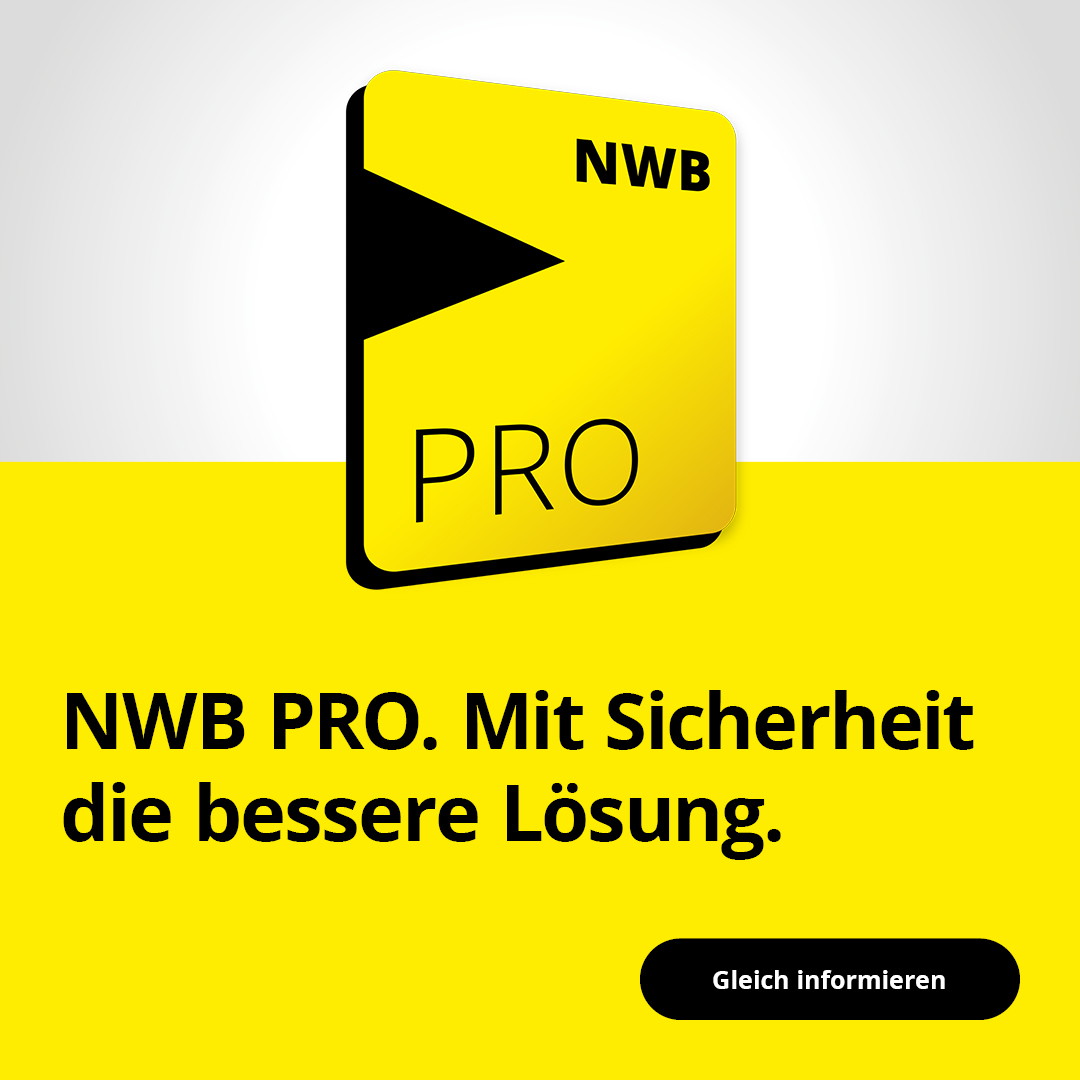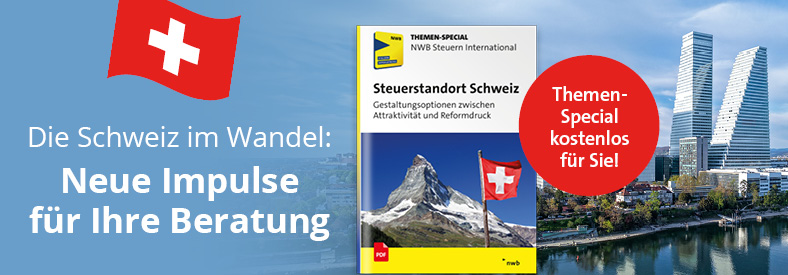Schweiz entscheidet mit Volksabstimmung für Abschaffung einer Steuer
Es kommt selten vor, dass eine Steuer wegfällt. Doch in der Schweiz werden Immobilieneigentümer ab 2029 eine Steuer nicht mehr zahlen. Der Eigenmietwert wird abgeschafft. Nach über 91 Jahren. Der was?
Die Abgabe ist ein absolutes Unikum der Schweiz. Bislang gilt: Wer eine Immobilie im Eigentum hat und sie selbst nutzt, muss den sog. Eigenmietwert als fiktives Einkommen versteuern. Der Betrag ist deutlich niedriger als eine ortsübliche Vergleichsmiete und beträgt eher 60–70 % des realistischen Mietzinses. Allerdings ist dieser Betrag in den letzten Jahren deutlich gestiegen. Im Gegenzug können bislang Instandsetzungskosten und Immobilienzinsen steuerlich abgesetzt werden.
Warum sollte man auf die fiktive Mietersparnis der eigenen Immobilie Steuern zahlen? Die Regelung stammt aus dem Wirtschaftskrisenjahr 1934, als die Eidgenossenschaft zusätzliche Einnahmen für Sozialleistungen und die Rüstung suchte. Zwischenzeitlich sollte das europaweit einzigartige Konstrukt viermal abgeschafft werden. Doch blieben frühere Anläufe erfolglos.
Die Abschaffung war auch bis zuletzt nicht sicher. In der Schweiz wohnt die Mehrheit der Bevölkerung zur Miete, nur 36 % der Schweizer leben in der eigenen Wohnung/im eigenen Haus. Aber in der Volksabstimmung vom 28.9.2025 wurde die Reform der Wohneigentumsbesteuerung mit 57,7 % Ja-Stimmen angenommen. Dazu bedarf es nun eines Gesetzes. Mit dessen Verabschiedung wird frühestens für das Steuerjahr 2028 gerechnet.
Die Folgen der Abschaffung
Mit der Annahme der Vorlage wird die systemfremde und von vielen als unfair empfundene Eigenmietwertbesteuerung in Gänze beseitigt. In Zukunft wird kein Eigenmietwert für Haupt- und Zweitwohnsitze mehr zu versteuern sein. Schuldzinsenabzüge sind nur noch eingeschränkt möglich (z. B. für neu erworbenes Wohneigentum nur in den ersten zehn Jahren). Vier von fünf Immobilieneigentümern werden von den Änderungen profitieren, in erster Linie ältere Immobilieneigentümer, die diese Steuer zahlen, aber ihre Hypothekenkredite abbezahlt haben und keine großen Renovierungen mehr planen.
Nach Meinung der Befürworter der Abschaffung werden zugleich Fehlanreize zur Verschuldung von Immobilieneigentümern abgebaut. Die Bauwirtschaft äußerte dagegen die Befürchtung, es könnte zu einem Einbruch bei Sanierungen und Klimaschutzmaßnahmen kommen. Unbestreitbar ist auch, können keine Abzüge mehr geltend gemacht werden, bedarf es keiner Rechnungen mehr; damit steigt der Anreiz für Schwarzarbeit – gerade durch Handwerker aus dem Ausland, heißt es.
Für Mieter hat die Reform keine direkten Auswirkungen; sie sind aber von den Folgen der Steuermindereinnahmen mitbetroffen bzw. sie werden an deren Kompensation beteiligt. Absehbar gehen so jährlich 1,8 Mrd. CHF Steuern (ca. 2 Mrd. €) verloren.
Darum wurde gleichzeitig mit dem Referendum über eine „Liegenschaftsteuer auf Zweitwohnsitze“ abgestimmt. Die Kantone erhalten damit zusätzliche Kompetenzen: Sie können selbst entscheiden, ob sie eine kantonale Objektsteuer auf selbstgenutzte Zweitwohnungen einführen. Besitzer von Ferienobjekten unterliegen dann (weiterhin) mit ihrem Zweitwohnsitz nicht nur der normalen Vermögenssteuer, sondern einer zusätzlichen Steuer. Es ist absehbar, dass in kleineren alpinen Gemeinden der Druck auf eine zusätzliche Steuer für Zweitwohnungen groß sein wird. Die Kantone dürfen außerdem Steuerabzüge für Sanierungen und Energiesparmaßnahmen regional fortführen. Vielleicht werden sie diese Hilfen sogar ausbauen.
Steuerstandort Schweiz
Und was gilt sonst für die Schweiz? Die Löhne sind hoch, die Steuern und Abgaben sind erträglich. Die Schweiz bietet durch ihre kantonalen Unterschiede und ihre internationale Offenheit viele Möglichkeiten zur steuerlichen Optimierung.